Chronik
Inhalt
I. Von den Anfängen bis 1931
II. Chorleiter Erhard Quack (1931 -1947)
III. Chorleiter Alfons Junkes (1947-1948)
IV. Chorleiter Josef Stein (1948-1971)
V. Chorleiter Christoph Baum (1971-1979)
VI. Chorleiter Gilbert Kunz (1980)
VII. Chorleiter DKMD Dietmar Mettlach (1980-2005)
VIII. Chorleiter Bernhard Sommer (2005-2013)
IX. Chorleiter Dekanatskantor Georg Treuheit (2013- )
Chronisten: Hans Gerstner (bis Dietmar Mettlach), danach Dr. Paul Landwich
I. Von den Anfängen bis 1931
In den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, also vor mehr als 150 Jahren, gab es schon Chorsängerinnen und -sänger in St. Jakobus, die ihren Dienst gemeinschaftlich versahen. Dies geht aus einer Urkunde des königlichen Landkommissariats Speyer vom 26.8.1828 hervor. In welcher Weise der Dienst verrichtet wurde, ob mehrstimmig gesungen wurde und ob eine Organisation bestand, darüber berichtet die Urkunde nicht. Mehrstimmige Kirchenmusik gab es jedenfalls von der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Vor der Gründung eines Pfarr-Cäcilien-Vereins aus gemischten Stimmen zeigten sich Schifferstadter Männerchöre zeitweilig bereit, in Gottesdiensten mehrstimmig zu singen. So entsprach der 1854 gegründete weltliche Männergesangverein dem Wunsch, seine Arbeit auch „dem Gottesdienst zu weihen, was von Herzen gern geschah“. Der 1876 gegründete Männerchor „Concordia“ übernahm 1880 auch Chordienst in St. Jakobus und nannte sich Cäcilienverein. 1882 versuchte der musikliebende Geistliche Rat Ripplinger die beiden Männerchöre „zwecks besserer und genügender Sangeskräfte“ zum Dienst in der Kirche unter einen Hut zu bringen. Dies misslang und führte sogar zu Misshelligkeiten. Der Männergesangverein 1854 unter seinem Dirigenten Isselhard gewann die Oberhand, und der Cäcilienverein „Concordia“ unter Dirigent Faust zog sich von der Tätigkeit in der Kirche zurück. In der Folgezeit sang also nur noch der Männergesangverein 1854 in den Gottesdiensten. Es sind gedruckte Statuten eines Pfarr-Cäcilien-Vereins Schifferstadt vom 5.6.1883 vorhanden, eines Vereins „von katholischen Männern zum Zweck der Pflege und Hebung des kirchlichen Gesangs nach den Grundsätzen des Allgemeinen Deutschen Cäcilienvereins“. Damaliger Dirigent dieses Chors war Lehrer Isselhard (nach einer Ausgabenliste von 1885/86). Dieser Pfarr-Cäcilien-Verein (Männerchor) ist sicherlich mit dem Männerchor 1854 identisch. Auf Dauer war dieser Chor mit seiner kirchlichen Aufgabe nicht zufrieden. „Je länger desto mehr ging es mit der Kirchenmusik zurück, nicht zuletzt unter der Unlust seiner damaligen Leitung. Die kirchenmusikalische Bürde war dem Chor schließlich unerträglich geworden, und sogar aus seinen eigenen Reihen ertönte nach kaum 10 Jahren der Ruf nach einer Reform an Haupt und Gliedern unter deutlichem Hinweis auf einen gemischten Chor“. (Aus einer Ansprache des Chorleiters Michael Sattel, 1918). Daß ein solcher für die Kirchenmusik der fast ausnahmslos gebräuchliche ist, dürfte aus der Tatsache erhellen, daß der Großteil der kirchenmusikalischen Kompositionen für gemischten Chor erscheint.
So betrieb der Geistliche Rat Ripplinger 1893 die Gründung eines Pfarr-Cäcilien-Vereins mit Frauen- und Männerstimmen. Zur ersten Chorprobe stellten sich bereits 40 Pfarrangehörige ein. Die weitere Werbung durch den Präses und seine Kapläne Mohr und Höffner hatte Erfolg. Der Chor wuchs bald auf eine Stärke von 60 Sängerinnen und Sänger heran, bei ausgeglichener Stimmbesetzung. Eine große Zahl passiver Mitglieder gab dem Chor finanzielle Stütze. Dirigent vom Gründungstag an war bis zum Jahre 1902 Lehrer Karl Friedrich Imo. 1901 fand die Fahnenweihe statt. Von 1902-1927 leitete Oberlehrer Michael Sattel den Chor. Am 18. April 1918 – noch während des 1. Weltkrieges – feierte der Pfarr-Cäcilien-Verein das 25jährige Bestehen. Nachfolger als Chorleiter war Oberlehrer Fridolin Storck (1927- 1931).
Der Chor sang bei den festtägigen Hochämtern das Ordinarium (Kyrie, Gloria, Sanctus mit Benedictus, Agnus Dei) und Teile des Propriums (Graduale, Offertorium) mehrstimmig. In den lateinischen Vespern wurde das Magnificat mehrstimmig gesungen. Die noch vorhandene Aufstellung des Noteninventars vom Jahre 1913 offenbart, daß der Chor sich fast ausschließlich auf die Wiedergabe von Werken des Cäcilianismus (ausgehendes 19. Jahrhundert) beschränkte, so wie es damals in den meisten katholischen Kirchenchören Gepflogenheit war. Jährlich wurde im Frühjahr oder zum Cäcilienfest ein Lieder- und Unterhaltungsabend veranstaltet, und der Chor nahm an Bezirkscäcilienfesten teil. Leider sind die Aufzeichnungen aus den ersten vier Jahrzehnten des Pfarr-Cäcilien-Vereins spärlich.
Organisten in dieser Zeit: Michael Sattel (von 1893 an), Joseph Stamer, Fridolin Storck.
Vorstände: Georg Valdenaire, Josef Wahl I., Markus Hoffmann, Philipp Lang.
II. Chorleiter Erhard Quack (1931 -1947)
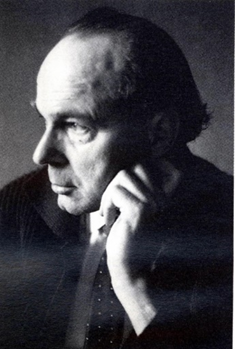
Chorleiter Erhard Quack erinnert sich:
Schifferstadt war mir seit den frühen Kindertagen ein Begriff. Wenn ich mit meiner Mutter von Kaiserslautern nach Speyer fuhr, um die älteren Geschwister zu besuchen, mussten wir in Schifferstadt umsteigen und warten. Auf dem Bahnsteig zog es mächtig, so dass Zahnweh und Schnupfen nur noch schlimmer wurden. Auch ein späterer Besuch in Schifferstadt bei meinem Bruder, der Kaplan in St. Jakobus war, vermittelte mir keinen deutlichen Eindruck von diesem Ort. So war es nicht verwunderlich, dass ich nie die Absicht hatte, mich je in Schifferstadt niederzulassen. Dennoch nahm ich im Frühjahr 1931 das Angebot der Regierung auf eine Lehrerstelle dort- selbst dankbar an, weil ich von da aus mein Musikstudium in Mannheim fortsetzen und vollenden konnte.
In dem alten Schulhaus, das jetzt nicht mehr steht, plagte ich mich mit Schifferstadter Kindern ab. Bald kam es auch zu ersten Kontakten mit der Kirchenmusik und dem Chor von St. Jakobus.
An Fronleichnam klopfte es frühmorgens um sechs Uhr an meine Zimmertür: „Herr Lehrer Storck ist krank; können Sie für ihn heute die Orgel spielen und den Chor dirigieren?“ Meine Antwort: „Ja, ich werde kommen.“ Eine Hallermesse mit Orgelbegleitung und einige Prozessionshymnen ließen sich aus dem Stegreif bewältigen. Im Herbst des gleichen Jahres quittierte ich den Schuldienst und übernahm (damals 27jährig) den Kirchenchor St. Jakobus Schifferstadt.
Meinem Ideal von Kirchenmusik entsprach das nicht. Aber ohne Revolte fing ich behutsam an, meine Zielvorstellungen auf diesem Gebiet zu verwirklichen, nämlich die Kirchenmusik als wesentlichen Bestandteil der Liturgie zu pflegen, d.h. als Ausdrucksform der feiernden Gemeinde. Mein erstes Interesse galt dem Volksgesang beim Kirchenlied und beim Gregorianischen Choral. Das Kirchenlied sollte enger mit der Liturgie verbunden werden. Deshalb wurden die uralten Lieder wie Christ ist erstanden, Gott sei gelobet und gebenedeiet usw. wieder hervorgeholt und neue liturgiegebundene Lieder geschaffen, die später im Salve Regina und Gotteslob ihren Platz fanden. Mit einiger Mühe übte ich auch Choralmessen mit der Gemeinde, und jeden Sonntag wurde ein Choralamt gefeiert. Das alles konnte ich nicht allein bewältigen. Pfarrer Hiller beobachtete mit Wohlwollen die Anfänge dieser Entwicklung; Pfarrer Weihmann, ein liturgiebegeisterter Seelsorger, griff aktiv mit ein. Er half mit bei den Volksgesangsstunden im Rahmen der sonntäglichen Christenlehre; er erklärte die Texte und ermunterte die Gemeinde zum Mitsingen; erforderte die Errichtung der Knabenschola, deren frischer Choralgesang auch die Gemeinde mitriss; er liebte das mehrstimmige Singen und den Wechselgesang zwischen Chor und Gemeinde; er unterstützte die Umwandlung des Cäcilienvereins in einen liturgischen Kirchenchor, neben meinem Studium die Organisten- und Chorleiterstelle in St. Jakobus. Dort herrschte seit Jahrzehnten eine gute cäcilianische Tradition, in der vor allem die epigonalen Meister des 19. Jahrhunderts und die Kirchenlieder der Aufklärungszeit und der Romantik gepflegt wurden.

Damit vollzog sich auch allmählich die Änderung im kirchenmusikalischen Repertoire: An Stelle der Cäcilianer traten Palestrina, Lasso, Haßler und zeitgenössische Komponisten. Damit auch an Feiertagen der Gemeindegesang zu seinem Recht kam, wurde die Mehrstimmigkeit mehr und mehr vom Ordinarium auf das Proprium verwiesen. Alte Propriumsvertonungen von Isaak, Aichinger, Kerle usw. mußten ediert werden. Zeitgenössische Komponisten (Waldbroel, Quack, Schien) wurden angeregt, neue Proprien zu komponieren.
Wie eine Vorwegnahme der Konzilreform kann es angesehen werden, dass neben der lateinischen Kirchenmusik auch deutscher Liturgiegesang geschaffen und gepflegt wurde: deutsche Ordinariumsmessen von Lahusen und Rohr, deutsche Psalmen und Hymnen in Vesper und Komplet und deutsche Lieder für die Eucharistiefeier. Vieles davon konnte ich in dem Büchlein „Lobsinget dem Herrn“ veröffentlichen, das 1941 zur Ergänzung des Diözesangesangbuches herauskam und das unter dem Naziregime nur in 100 Exemplaren gedruckt werden durfte. Das neue Salve Regina und Gotteslob haben manches davon übernommen. So war St. Jakobus gewissermaßen ein Experimentierfeld für den neuen Gemeindegesang im Gottesdienst geworden.
Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß hier auch eine Pflegestätte außerliturgischer geistlicher Musik war. In kirchenmusikalischen Andachten kamen Liedsätze und Motetten verschiedener Meister, Liedkantaten von Kraft und Dombrowsky, Choralmotetten von Bach, Senfl und Brahms, das „Te Deum’von Hermann Schröder und Orgelmusik aller Art zu Gehör. Die Fülle der Arbeit hätte ich nicht leisten können, wenn eine begeisterungsfähige Gemeinschaft, für die sie bestimmt war, sie nicht mitgetragen hätte: die Pfarrgemeinde von St. Jakobus und der zu ihr gehörende Kirchenchor. Es war für mich beglückend zu erleben, wie die ausgestreute Saat aufging, wie die Anregungen aufgenommen wurden, mit welch außergewöhnlicher Treue und Zuverlässigkeit die Chormitglieder in Proben, Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen ihren Dienst versahen. Täglich fanden sich einige Sängerinnen und Sänger als Schola zur Feier des Frühgottesdienstes ein; jeden Sonntag und Feiertag der ganze Chor zum Choralgesang und den mehrstimmigen Teilen des Amtes.
Es konnte nicht ausbleiben, dass dieser Chor auch über die Grenzen der Pfarrgemeinde und des Bistums hinaus Beachtung fand und engagiert wurde, so beim ersten Diözesanmusiktag 1936 mit der Missa Dona nobis pacem von H.M. Wette, die dann auch der Rundfunk Saarbrücken übertrug, beim Katholikentag in Mainz zu einem Konzert im Dom und bei einer Tagung der internationalen Gesellschaft für katholische Kirchenmusik ebenfalls in Mainz mit neuen Propriumsgesängen von Waldbroel und Quack.
In die Schifferstädter Zeit fällt auch die Gründung einer Ausbildungsstätte für Kirchenmusik, die 1935 mit den „Kirchenmusikalischen Lehrgängen“ begann und 1941 als „Bischöfliches Kirchenmusikalisches Institut des Bistums Speyer“ ausgebaut wurde. Aus allen Teilen des Bistums pilgerten wöchentlich junge Leute nach Schifferstadt, um sich in Kirchenmusik ausbilden zu lassen.
Es entsprang nicht meinen Absichten, sondern dem Wunsch von Bischof Josef Wendel, dass ich 1947 als Domkapellmeister und Diözesankirchenmusikdirektor nach Speyer berufen wurde. So ist es zu verstehen, dass ich mit einer gewissen Wehmut von Schifferstadt Abschied nahm in dem Bewusstsein, nie mehr ein so schönes und ideales Arbeitsfeld zu finden wie hier im Schatten von St. Jakobus.
Organisten in dieser Zeit: Erhard Quack, Alfons Junkes, Dorothea Uhl.
Vorstände: Markus Hoffmann, Konrad Magin.
III. Chorleiter Alfons Junkes (1947-1948)

Lehrer Alfons Junkes, Kirchenmusiker und schon seit Jahren Sänger im Kirchenchor St. Jakobus, übernahm nach dem Weggang von Quack in dankenswerter Weise auf ein Jahr die Leitung des Chors. Er hielt den Chor zusammen und sorgte dafür, dass die Tradition nicht abriss.
IV. Chorleiter Josef Stein (1948-1971)
Chorleiter Josef Stein erinnert sich:
Seit 1930 war ich in allen Orten, wo ich als Lehrer wirkte, auch als Kirchenmusiker tätig. Noch während meiner Kriegsgefangenschaft (1946) erging an mich die Frage, ob ich bereit wäre, nach meiner Heimkehr die Nachfolge Erhard Quacks anzutreten. Die liturgische und musikalische Arbeit meines Lehrers Quack schätzte ich hoch, und so gab ich mit Freuden die Zusage. Eine freigewordene Lehrerstelle in Schifferstadt konnte ich (damals 38jährig) erst im September 1948 übernehmen. Unter dem kommenden ehrenamtlichen Engagement durfte meine berufliche Arbeit und meine Familie nicht leiden, und ich vertraute auf meine stabile Gesundheit.
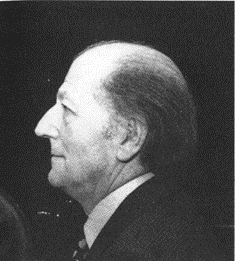
Im November übernahm ich den Jakobuschor. Dieser (38 Sängerinnen und Sänger) war in stimmlicher Zusammensetzung sehr gut proportioniert, leistungsfähig, jung, einsatzfreudig. Es herrschte ein guter Geist. Auf Wunsch von Pfr. Weihmann fanden die Choralämter nur noch 14tägig statt. Das übernommene stattliche mehrstimmige Repertoire und auch die gregorianischen Proprien wurden weiter gepflegt. Es wurden mehrstimmige lateinische und deutsche Proprien, Ordinariumsgesänge (von der Renaissance bis zur Moderne) und Motetten einstudiert. Neben der häufigen Gestaltung von Hochämtern wurden kirchenmusikalische Feierstunden veranstaltet. Der Chor war an der Gestaltung aller seit 1950 in dreijährigem Abstand stattfindenden Diözesanmusiktagen im Speyerer Dom an hervorragender Stelle beteiligt. Mehrere Feierstunden und Kirchenkonzerte gestaltete er in Gemeinschaft mit dem Speyerer Domchor. Er nahm an allen seit 1949 stattfindenden Dekanatsmusiktagen teil, die von mir als Dekanatschorleiter organisiert wurden.
An größeren Werken wurden in meiner Zeit einstudiert: „Te Deum“ von A. Bruckner, Motette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ von J.S. Bach, Motette „Komm, Heilger Geist“ von E. Quack, vier eucharistische Hymnen und Psalm 97 „Singet dem Herrn“ von W. Waldbroel; Doppelchöre von G. Gabrieli, J. Pachelbel, H. Schütz-, „Vesperae solemnes de Confessore“ von W.A. Mozart; „DettingerTeDeum“ von G.F. Händel; drei Messen von W.A. Mozart (darunter die „Krönungsmesse“); Messen von Palestrina, Rathgeber, Hilber, Flor Peeters, Quack und J. Stein-, Kantate „Das neugeborene Kindlein“ von D. Buxtehude, weitere Kantaten der Barockzeit; „Die Christnacht“ von J. Haas-, Marienlieder von J.B. Hilber, „Ave Maria“ von A. Bruckner, Lauretanische Litanei von W.A. Mozart.
Auch das weltliche Lied wurde gepflegt, wenn auch in geringerem Ausmaß (drei Konzerte). So wurde die gesellige Seite nicht vernachlässigt. Innerhalb des Chors fanden jährlich Nikolausfeier, Ausflug und Unterhaltungsabend in der Fastnachtszeit statt.

In den Jahren 1949 bis 1970 machte der Südwestfunk jährlich ein bis zwei Bandaufnahmen vom Kirchenchor St. Jakobus. So war dieser ein in sonntäglichen katholischen Morgenfeiern und werktäglichen Morgenandachten sehr oft zu hörender Kirchenchor der Diözese. Auch zur Gestaltung auswärtiger Feiern wurde er gebeten, wie Weihnachtsfeier der Neustadter Katholiken, Diözesantage der Jugend in Kaiserslautern und Pirmasens, Pfälzer Katholikentage in Johanniskreuz, Vorderpfälzer Katholikentag in Ludwigshafen, Abschlußfeier bei der Konsekration der St. Bernhardskirche in Speyer, Kundgebung auf dem Domplatz beim Domfest 1961, 110. Gründungstag des Kirchenchors St. Marien in Neustadt, 100jähriges Bestehen der Kirchenchöre Edenkoben und Maikammer, Liturgische Tagung in Speyer, Kirchenkonzert in Neustadt (DettingerTe Deum), mehrstimmige Vesper in der Benediktinerabtei Stift Neuburg u.a. 1963 fand in St. Jakobus unter der Trägerschaft der Stadt ein Konzert des Hamburger Orgelvirtuosen Prof. M.G. Förstemann statt, wobei der Chor zwischen den Orgelwerken einige Motetten sang. Förstemann sandte hernach einen Brief an den Bürgermeister der Stadt und an mich folgenden Inhalts: „Als man mir mitteilte, ich möchte mich mit der Mitwirkung des Kirchenchors einverstanden erklären, dachte ich: Muss das wirklich sein? Diese meine Gedanken beruhen auf unangenehmen Erfahrungen, die ich diesbezüglich hier und da machen musste. Mit dieser Einstellung – das sei offen gesagt – erwartete ich nun das, was im Anschluss an meine Improvisationen kommen würde. Der Klang und das musikalische Singen des St. Jakobuschors zeigten mir sogleich, dass es sich hier um eine Chorgemeinschaft handelt, wie man ihr nur selten begegnet… Ich bin Chorgesang gegenüber äußerst kritisch. Um Ihren Chor können Sie viele Großstädte und repräsentative Kirchen beneiden. Seine Klangkultur, die Frische des Singens, der elastische, schmiegsame und differenzierte Klang und die Ausgewogenheit der Stimmen faszinierten mich, und ich hatte große Freude an unserem gemeinsamen Musizieren.“ Die Chormitglieder freuten sich sehr über diese Bewertung.
Die Chorstärke fluktuierte in meinen Jahren zwischen 40 und 56. In diese Zeit fiel auch die Tieferlegung und Verkürzung der Orgelempore. Die alte Orgel aus der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts stand vor dem Turm. Das neue Werk (1952), in das mehrere Register des alten übernommen wurden, musste großteils in den Nischen seitlich des Turms angebracht werden. Mechanische Traktur war nicht mehr möglich. Die Pfeifen des I. und II. Manuals und des Pedals stehen nicht mehr quer zum Schiff, sondern längs in den tiefen Nischen. Beim Orgelbau – er schloss eine große Kirchenrenovierung ab – musste sehr gespart werden, besonders hinsichtlich der Orgelmetalle. So nahe dem Ende des 2. Weltkriegs war von einem Wirtschaftswunder noch nichts zu spüren.
Die Zusammenarbeit mit den Pfarrern Petrus Maria Weihmann, Joseph Schwartz, Gerhard Wagner und Rudolf Gieser in Bezug auf die Chorarbeit kann ich nur rühmen.
1959 wurde ich aufgrund meiner kirchenmusikalischen Arbeit in der Pfarrei und auf Diözesanebene durch Bischof Isidor Markus Emanuel zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Aus gesundheitlichen Gründen musste ich ab 1969 in meinem kirchenmusikalischen Engagement kürzer treten und im November 1971 schweren Herzens die mir liebgewordene Chorleitung abgeben. Daß mir der Chor so liebgeworden war, dazu hatten wesentlich die Sängerinnen und Sänger beigetragen, und ich möchte ihnen an dieser
Stelle nochmals Dank aussprechen. Als sehr beglückend habe ich immer wieder das gegenseitige Vertrauen und das menschlich gute Verhältnis empfunden. So danke ich auch den beiden Organisten Hugo Funk und Hubert Mayer, die mir mit ihrem künstlerischen Spiel langjährig wertvolle Mitarbeiter waren in feierlichen Gottesdiensten und Konzerten.
Kompositorische Arbeit: In meiner Schifferstadter Zeit arbeitete ich auch auf diesem Gebiet. 1952 schrieb ich für das Orgelbuch des neuen Salve Regina 44 Liedbegleitsätze. In der Vorbereitungszeit zum Gotteslob beteiligte ich mich mit Erfolg an der Kompositionsausschreibung der Kyrielitanei „Du rufst uns, Herr, trotz unsrer Schuld“ (GL 523). Nach Erscheinen des Gotteslob vertonte ich die wichtigsten Vespern für drei verschiedene Besetzungen, die in den Chören weit verbreitet sind. Ferner schrieb ich Liedsätze, elf Gesänge zu Advent, Weihnachten und Erscheinung des Herrn, eine Kantate zu GL 538, Motetten und zwei Deutsche Messen (Schola, 4st. gem. Chor, Orgel und Trompete; Schola, 4st. gem. Chor bzw. 3 gl. St. und Orgel)
Auszeichnungen: 1980 Päpstlicher Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“; Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland; 1990 Ehrenplakette in Silber der Stadt Schifferstadt.
Organisten in dieser Zeit: Josef Stein, Hugo Funk, Hubert Mayer, Josef Nist, Johannes Schimpf, Sr. M. Gunhild (OP), Klara Dentler, Marianne Koch.
Vorstände: Markus Sturm, Hans Gerstner
V. Chorleiter Christoph Baum (1971-1979)

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger, der im Sinne der beiden Vorgänger im Chorleiteramt, Erhard Quack und Josef Stein, den Chor von St. Jakobus leiten sollte, fiel die Wahl auf den 28jährigen Lehrer Christoph Baum. Ende November 1971 übernahm er den Chorleiterdienst an der St.- Jakobus-Kirche.
1943 in Pirmasens geboren, besuchte Christoph Baum während seiner Gymnasialzeit von 1959-62 die Außenstelle des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts in Pirmasens und schloß mit der Kirchenmusikerprüfung ab. Nach bestandener Lehrerprüfung unterrichtete er an den Volksschulen in Pirmasens und Landstuhl, bis er zu Beginn des Schuljahres 1971/72 an die Grund- und Hauptschule Nord in Schifferstadt wechselte.
Der Wechsel der Dienstorte war nicht zuletzt mit der Ausübung des Organisten- und Chorleiterdienstes verbunden. Zunächst Kirchenmusiker in Pirmasens-St. Elisabeth, dann mit gleicher Tätigkeit in der Pfarrei Landstuhl-Hl. Geist, übernahm er Ende 1971 die Chorleiterstelle an der St. Jakobus-Kirche. Christoph Baum verstand sich in der Tradition seiner Vorgänger Quack und Stein, wenn er die Aufgaben des Kirchenchors darin sah, in erster Linie „in der Liturgie, im Gottesdienst das Lob Gottes zu singen, und zwar regelmäßig, nicht nur an Hochfesten“ (zit. nach Chr. Baum).
1. Liturgischer Dienst
Der Chor gestaltete weitgehend im 14-tägigen Turnus die Choralmessen sonntags um 8 Uhr; später alle 6 Wochen den Vorabendgottesdienst Samstagabends. Hinzu kam die feierliche Gestaltung der Gottesdienste an den kirchlichen Hochfesten mit Vespern. Darüber hinaus sang der Chor bei Beerdigungen und dem 1. Sterbeamt nächster Angehöriger von Chormitgliedern. Als Selbstverständlichkeit galt auch der feierliche Gesang bei Hochzeitsämtern von Chormitgliedern. Unermüdlicher Mitarbeiter als Organist in all diesen Jahren war Hubert Mayer.

2. Weitere kirchenmusikalische Tätigkeiten des Chors
Stetige, engagierte und fachmännische Chorarbeit bringt nicht nur außergewöhnliche Ergebnisse im liturgischen Singen, sie findet ihre Ergänzung auch in kirchenmusikalischen Konzerten innerhalb und außerhalb der Heimatpfarrei. Ein erster Anlaß war gegeben zum zehnjährigen Bestehen des Kirchenchors Herz Jesu. So fand am 24.9.1972 ein gemeinsames Kirchenkonzert der Kirchenchöre von Herz Jesu, St. Jakobus und des Ökumenischen Chors unter der Leitung von Hugo Funk, dem Chorleiter von Herz Jesu, statt.
Weitere bedeutende kirchenmusikalische Feierstunden:
– Mai 1973 in Steinbach/Glan
– 14.9.75 in Eußerthal
– 14.12.75 in St. Jakobus (Adventskonzert)
– 12.12.76 in St. Jakobus (Adventskonzert)
– 24.4.77 in Diedesfeld
– 10.7.77 in Böhl (Verabschiedung von Pfr. Schütt)
– 3.10.77 in St. Jakobus (Schubert-Messe Nr. 2 in G- Dur, Bachmotette „Lobet den Herrn, alle Heiden“ u.a.)
– 16.9.79 in Enkenbach (letztes Konzert mit Chorleiter Baum)
Darüber hinaus gestaltete der Jakobuschor Festmessen in Schifferstadt, Rödersheim und Diedesfeld. Hervorgehoben sei der Festgottesdienst anläßlich des 65. Geburtstages von KMD Josef Stein am 12.1.1975 mit der „Deutschen Festmesse“ von J. Stein. In Erinnerung bleiben wird auch die „Barockmesse“ am Ostersonntag 1974 mit Valentin Rathgebers „Missa in F“. Ein Ereignis ganz besonderer Art und zugleich unvergeßlich dürfte die Teilnahme des Chors beim internationalen Kongreß „Universa Laus“ am 5./6.9.1974 in Straßburg gewesen sein.
Außerdem gestaltete der Chor seit 1973 alljährlich eine Messe am 1. Adventssonntag im Altenheim St. Matthias und mehrere Waldgottesdienste auf dem Totenkopf. Auch bei den Dekanats- und Diözesanmusiktagen, dem Katholikentag in Johanniskreuz sowie bei Rundfunkaufnahmen wirkte der Jakobuschor mit.
Die Chorstärke unter der Führung Christoph Baums schwankte immer zwischen 40 und 50 Stimmen. Damit hatte Christoph Baum das „Sängerpotential“ für eine gute, solide Chorarbeit zur Hand. Die Gestaltung der innerpfarreilichen Choralmessen und die recht hohe Zahl von Konzerten in der Pfarrei selbst und auswärts bestätigten die gute und ausgezeichnete Chorarbeit unter diesem Dirigenten. Aber eines Tages zerbrach der Konsens zwischen Chorleiter Christoph Baum und Pfr. Rudolf Gieser, aber ebenso zwischen dem Dirigenten und dem Vorstand sowie Teilen des Chors. Dieses Zerwürfnis führte letztlich am 29.9.1979 zum unweigerlich sofortigen Rücktritt Christoph Baums als Chorleiter von St. Jakobus.
Der frühere Chorleiter, KMD Josef Stein, fand sich dankenswerterweise bereit, dem Jakobuschor bis zur Ernennung eines neuen Chorleiters erneut vorzustehen: Advent und Weihnachten standen vor der Tür, und ein Hochfest ohne Chor – unvorstellbar! Als Interims-Chorleiter führte Stein den Chor vom 1.10.1979 bis zum 6.1.1980. Mit einer konzertant gestalteten Festmesse am Vorabend des Festes Erscheinung des Herrn (Dreikönigsfest) verabschiedete sich Stein an seinem 70. Geburtstag ein zweites Mal als Chorleiter.
Organisten in dieser Zeit: Christoph Baum, Klara Dentler, Hubert Mayer, Josef Stein
Vorstände: Hans Gerstner und Liesel Eckrich (1971 -73); Erich Mayer und Liesel Eckrich (1973-79)
VI. Chorleiter Gilbert Kunz (1980)

Die plötzliche Aufgabe der Chorleitertätigkeit durch Christoph Baum hatte viel Unruhe unter den Chormitgliedern erzeugt. Mit der Wahl des Oberstudienrats Gilbert Kunz, der hauptberuflich an einem Speyerer Gymnasium Musik unterrichtete, aber auch über viele Jahre als Chorleiter verschiedenen Chören vorstand, glaubte man, den Leiter für den Jakobuschor gefunden zu haben, der mit Autorität, Sachverstand und notwendigem psychologischem Einfühlungsvermögen die noch immer unterschwellig spürbare Erregung und Unruhe bei vielen Sängerinnen und Sängern glätten könne und mit einer für die Mehrheit der Chormitglieder überzeugenden zukunftsbetonten Konzeption den Chor zu neuen Leistungsanreizen führen würde. Doch die Hoffnung war trügerisch. Die neue Konzeption des Chorleiters Gilbert Kunz brachte erneute Unruhe und verstärkte Choraustritte in die Chorgemeinschaft. Schnell mußte von den Verantwortlichen gehandelt werden, sollte diese traditionsreiche Chorgemeinschaft nicht über kurz oder lang zerfallen. In einer Jahresversammlung des Chors am 14.3.1980 erklärte Pfr. Rudolf Gieser den Rücktritt des Chorleiters Gilbert Kunz.
Ein weiteres Mal war nun die Person von KMD Josef Stein gefordert, bis zum 1.7. den St.-Jakobus-Chor zu leiten. In seiner neuerlichen Antrittsrede am 11.4.1980 sprach der „neue“ Chorleiter Stein davon, „daß er durch die Vordertür hinausgegangen sei, sich aber durch die Hintertür wieder eingeschlichen hätte“ (Auszug aus dem Protokoll). Am Sonntag, dem 27.4.1980 gestaltete der Chor unter der Leitung Josef Steins die Festmesse zum Silbernen Priesterjubiläum Pfr. Giesers in der St.Jakobus-Kirche.
VII. Chorleiter DKMD Dietmar Mettlach (1980-2005)

Dem Jakobuschor nach den Stürmen der vergangenen Monate, der inneren Zerrissenheit endlich eine feste Führungsperson zu vermitteln, war Gebot der Stunde. Die Wahl fiel auf den neuen Diözesankirchenmusikdirektor (DKMD) Dietmar Mettlach, der zur selben Zeit am Kirchenmusikalischen Institut der Diözese in Speyer sein neues Amt als Nachfolger von DKMD Georg Pfeifer antrat. Mettlach wünschte selbst als Ausgleich seiner Arbeit am Bischöflichen Amt für Kirchenmusik (BAK) und am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut (BKI) eine Chorleiterstelle.
Dietmar Mettlach, Jahrgang 1950, gebürtiger Baumholderer, studierte schon mit 14 Jahren aufgrund seiner außerordentlichen musikalischen Begabung an der Hochschule für Musik in Mainz Katholische Kirchenmusik und legte hier auch sein A-Examen ab. Danach war er von 1969 bis 1977 als Kantor in Idar-Oberstein, später als Kantor in Neunkirchen-Wiebelskirchen und als Regionalkantor des Bistums Trier tätig, bevor er im Juli 1980 zum DKMD der Diözese Speyer berufen wurde. Zur gleichen Zeit übernahm er die Chorleiterstelle in St. Jakobus.
Dietmar Mettlach will Chorarbeit in erster Linie liturgiebezogen sehen, da sie dem Gottesdienst dienen soll, wobei jedoch der konzertante Anspruch nicht vernachlässigt werden dürfe. Kirchenmusik müsse, da stimme er mit Kardinal Ratzingervollkommen überein, immer“künstlerische Transposition des Glaubens“ sein. Auch sieht er im großen Schatz der Kirchenmusik ein weites Betätigungsfeld, so daß man sich nicht auf eine Stilepoche festlegen dürfe. Mettlach ist sich des konziliaren Auftrags hinsichtlich des Einsatzes der Kirchenmusik voll bewußt (sinngemäße Wiedergabe nach Tagblattartikel vom 21.10.1980). Später relativierte Mettlach seine ursprüngliche Auffassung über Chorarbeit, indem er die Meinung vertrat, daß der Chor „ständig unter Strom stehen“ müsse und sich die „Chorarbeit nicht alleine auf das Absolvieren liturgischer Verpflichtungen beschränken dürfe, sondern auch größere Werke erarbeitet werden müßten“ (Tagblattartikel vom 7.8.1981). Seitdem erzog er den Chor von St. Jakobus zu einem leistungsfähigen Oratorienchor.
1. Liturgischer Dienst
Mit der Übernahme des Chors durch Dietmar Mettlach gab es auch schon bald einige Änderungen. So wurde der bisherige 14-tägige Turnus des gesungenen Choralamtes abgeschafft, ebenso die zeitliche Festlegung auf morgens 8 Uhr. Der Gesamtchor gestaltete künftig einmal im Monat eine besonders kirchenmusikalisch ausgestaltete sonntägliche Messe, die auch als Vorabendmesse angeboten werden konnte. Überhaupt erfolgte künftig keine Fixierung mehr auf den 8-Uhr-Gottesdienst; grundsätzlich konnte jeder Gottesdienst zum „Hochamt“ werden. Da für jeden gesungenen Gottesdienst eine halbstündige Einsingphase vorgeschoben wurde, ergab sich fast automatisch eine Ausrichtung des „gesungenen Amtes“ auf den 10-Uhr-Gottesdienst. Das frühere „Choralamt“ wurde jeweils am 1. Sonntag des Monats als rein gregorianisch gesungenes Amt beibehalten, und zwar um 8 Uhr morgens. Dieses Singen des lateinischen Chorals oblag einer aus ca. 5 Mitgliedern bestehenden Männerschola. Diese Männergruppe wurde darüber hinaus auch sehr oft bei den vom Gesamtchor gestalteten Gottesdiensten eingesetzt. Das liturgische Singen an den Hochfesten, insbesondere an den Kar- und Ostertagen, wurde weitergeführt. Eingeschränkt wurde jedoch das Singen bei Sterbefällen naher Verwandter; hier sollte nach Rücksprache mit den Hinterbliebenen eines der drei Sterbeämter vom Chor gesungen werden.
2. Weitere kirchenmusikalische Tätigkeiten

Dietmar Mettlach wollte von Anbeginn an der Kirchenmusik neue Akzente setzen. Zunächst führte er als Einstimmung auf den Gottesdienst 10 Minuten vor dem 10-Uhr-Gottesdienst eine „kurze Kirchenmusik“ ein, die überwiegend instrumental dargeboten wurde. Schon bald wurde die Probenarbeit auf das Einstudieren größerer Werke ausgerichtet. Intensive Chorarbeit und vor jedem größeren Werk eine Chorfreizeit in Maria Rosenberg, später auch im Herz-Jesu-Kloster, ermöglichten jährlich die Aufführung von ein bis zwei Konzertwerken, die den Rahmen der von Dietmar Mettlach gegründeten Konzertreihe „Pfälzische Chortage für geistliche Musik“ bildeten. Eröffnet wurde die große Reihe solcher Werke mit Vivaldis Gloria, später folgten Meisterwerke von Bach, Händel, Monteverdi, Beethoven, Verdi u.a. Doch damit nicht genug: Der Chor gestaltete zu den Hochfesten jeweils am 2. Weihnachtsfeiertag und am Ostermontag sogenannte Orchestermessen, die sich bis heute großer Beliebtheit bei den Kirchenbesuchern erfreuen. Darüber hinaus führte der Chor unter Leitung seines Dirigenten des öfteren die Erst- oder Zweitaufführung eines kirchenmusikalischen Werkes außerhalb Schifferstadts, z.B. in Wörth, Frankenthal, Speyer, Enkenbach und Klingenmünster auf. A-Capella-Konzerte zur Finanzierung verschiedener Vorhaben gelangten in Diedesfeld, Oggersheim, Sondernheim, Ottersheim und Mannheim-Vogelstang zur Aufführung.
Genannt werden muß in diesem Zusammenhang auch die Gestaltung von Gottesdiensten bei mehrtägigen Reisen des Chors, so z.B. in Einsiedeln, Wien und Salzburg und für eine große Gruppe des Chors in Rom und Assisi.
Weitere Verpflichtungen für den Chor ergaben sich durch Heiraten und Silberhochzeiten von Chormitgliedern, im dreijährigen Turnus die Gestaltung des Festgottesdienstes an Fronleichnam, bei den Waldgottesdiensten der Pfarrei auf dem Totenkopf, im Altenheim St. Matthias zum 1. Advent, beim alljährlichen offenen Adventssingen in der St.-Jakobus-Kirche und bei Rundfunf- und Fernsehaufnahmen.
3. Kinder- und Jugendchor „Junge Kantorei“
Mit dem Blick in die Zukunft gründete Dietmar Mettlach 1989 die Singschule St. Jakobus Schifferstadt und deren Konzertchor „Junge Kantorei“. Die kleine Chorgemeinschaft wuchs rasch und schon bald hatte Dietmar Mettlach einen Kinderchor geformt, der über die Grenzen Schifferstadt bekannt wurde. Mit Konzertreisen nach z.B. Amerika, Japan oder Schweden belegte man die außerordenliche Qualität der jungen Sängerschar. Diverse CD-Aufnahmen folgten und 1997 gründete Dietmar Mettlach den Knabenchor St. Jakobus.
Nach 25 Jahren segensreicher Arbeit in Schifferstadt beendete Dietmar Mettlach seine Arbeit in St. Jakobus und hinterließ ein großes musikalisches Erbe.
Organisten in dieser Zeit: Dietmar Mettlach, Hubert Mayer, Dagmar Neubauer, Sonja Pfeifer, Jürgen Reimer, Josef Stein.
Vorstände: Markus Sturm (1979-89; danach „Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit“), ihm zur Seite standen als 2. Vorsitzende zuerst Liesel Eckrich, dann Christel Gerstner; Nachfolgerin als 1. Vorsitzende wurde Christel Gerstner, als 2. Vorsitzende zunächst Beate Mayer und später Paul Landwich.
VIII. Chorleiter Bernhard Sommer (2005-2013)

Begleitet durch ein Gremium von drei Kirchenmusikern machte sich die Kirchengemeinde St. Jakobus 2005 auf die Suche nach einem Nachfolger von DKMD Dietmar Mettlach. Nach einem Auswahlverfahren entschied man sich für den damals 27-jährigen Bernhard Sommer. Der junge Student hob sich durch seine Musikalität und seiner Begeisterungsfähigkeit von den Mitbewerbern ab.
Bernhard Sommer hat in seiner Jugend am Bischöflichen Institut für Kirchenmusik in Speyer sein C-Examen abgelegt und den Kirchenchor in Ellerstadt geleitet. Zur Zeit der Übernahme des St. Jakobuschores befand sich Sommer in der Endphase seines Studiums zum Gymnasiallehrer in den Fächern Musik und Deutsch. Die Chemie zwischen dem neuen Dirigenten und dem Chor stimmte sofort, was auch musikalisch schon nach wenigen Proben spürbar wurde. Es war für den jungen Musiker ein große Herausforderung den Chor nicht nur für die Gottesdienste, sondern auch für die Orchestermessen an Weihnachten und Ostern, sowie die Konzerte zur Konzertreihe vorzubereiten. Doch schon nach dem ersten Jahr war der Kirchenchor wieder auf voller Fahrt und konnte unter der neuen Leitung musikalische Höchstleistungen abrufen.
In den folgenden Jahre reifte Bernhard Sommer zum erstklassigen Chorleiter und Dirigenten, der auch von großen Orchestern und Gesangssolisten als musikalische Führungspersönlichkeit anerkannt wurde. Und so kamen großartige Werke unter seiner Leitung zur Aufführung, die allseits Beachtung fanden. Zu nennen sind hier u.a. das Weihnachstoratorium von J.S. Bach, „Ein deutsches Reqiuem“ von J. Brahms oder das Magnificat von J. Rutter.
Aber noch zwei weitere Eigenschaften machten ihn für Schifferstadt zum Glücksfall. Dies war zum einen seine tiefe Verbundenheit zur Kirche, durch die er sich immer bewusst war, dass die erste Aufgabe des Kirchenchors die Mitgestaltung der Gottesdienste ist. Die zweite Eigenschaft war die Geselligkeit, welche er in das Chorleben einbrachte. So war es auch der Initiative von Bernhard Sommer zu verdanken, dass der Chor nach vielen Jahren mal wieder eine mehrtägige Chorreise nach Görlitz unternahm. Seine Auftritte bei der Chorfastnacht, als musikalischer Kabarettist oder gar im Trompetenduett mit dem 1. Vorsitzenden Dr. Paul Landwich sind weiter Zeugnisse seiner Liebe zur Geselligkeit.
Erwähnt sei an dieser Stelle ebenfalls, dass Bernhard Sommer durch die Übernahme des Chors, seine zukünftige Frau in Schifferstadt kennenlernte. Erwähnenswert deshalb, weil seine Frau, die Ärztin Dr. Katharina Sommer, die Tochter seines künstlerischen Vorgängers Dietmar Mettlach ist. Die beiden heirateten 2008 in St. Jakobus Schifferstadt und in den folgenden Jahren bekamen sie ihre Kinder Clara und Johannes.
Durch seine Verpflichtungen gegenüber der jungen Familie und seiner neuen Schule in Hockenheim wurde es für Bernhard Sommer allerdings immer schwerer die nötige Zeit für die Arbeit in Schifferstadt aufzubringen. Es widerstrebte seinem hohen musikalischem Anspruch in Schifferstadt zeitlich kürzer zu treten, weshalb er Ende 2011 das Gespräch mit der Vorstandschaft suchte und um seine Entpflichtung bat. Mit großer Bestürzung, aber vollstem Verständnis für die Situation des jungen Musikers nahm man die Entscheidung entgegen.
Die Suche nach einem Nachfolger gestaltetet sich schwierig, doch zum Glück versprach Bernhard Sommer so lange zu bleiben, bis die Übernahme geklärt sei. Ende 2012 zeichnete sich endlich eine Lösung ab. Dekanatskantor Georg Treuheit, der neben seiner Arbeit für das Bistum Speyer bislang den Kirchenchor in Maudach geleitet hatte, wollte nach Schifferstadt wechseln. Schweren Herzens verabschiedete man sich im Frühjahr 2013, nach 8 Jahren fruchtbarer Zusammenarbeit, von Bernhard Sommer als Leiter des Kirchenchors.
Organisten in dieser Zeit: Hubert Mayer, Christoph Baum, Dagmar Sold
Vorstände: Dr. Paul Landwich und als 2. Vorsitzender Steffen Hammer, der später durch Luise Kessler abgelöst wurde.
IX. Chorleiter Dekanatskantor Georg Treuheit (2013- )

Dekanatskantor Georg Treuheit ist seit 1994 Dekanatskantor in Ludwigshafen und Speyer. Zudem ist er Dozent für Stimmbildung am Bischöflichen Priesterseminar Speyer und am Bischöflichen Kirchenmusikalischen Institut Speyer für die Fächer Kinderchorleitung, Chorpraktisches Klavierspiel und Orgelbau. Treuheit ist außerdem Diözesanbeauftragter für die Kinderchöre im Pueri-Cantores-Verband
im Bistum Speyer und Mitglied im Arbeitskreis Neues Geistliches Lied der Diözese Speyer. Er studierte Kirchenmusik an der Kirchenmusikhochschule St. Gregorius-Haus Aachen und arbeitete dann als Kirchenmusiker in Düsseldorf-Mettmann und als Dozent am Kirchenmusikseminar Essen. Privat studierte er Gesang in Köln, Mannheim und Dresden.
Der Wechsel in der Chorleitung von Bernhard Sommer zu Georg Treuheit gestaltete sich problemlos. Natürlich „beschnupperte“ man sich in den ersten Wochen gegenseitig und musste sich aufeinander abstimmen, doch schon bald war klar, dass man mit Georg Treuheit einen Chorleiter von Format bekommen hatte. Besonderen Wert legte Treuheit von Anfang an auf die Stimmbildung und konzentrierte Probenarbeit, die aber immer wieder durch seine rheinische Frohnatur aufgelockert wird. Berühmt ist er für sein Talent innerhalb eines Musikstücks Parallelen zu anderer Musik zu finden und diese dann auch zu spielen. So kann es schon mal vorkommen, dass ein alter Schlager bei der Probe eines klassischen Meister
erklingt.